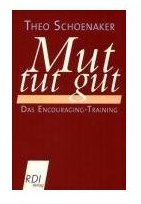Clemens J. Setz: Die Frequenzen
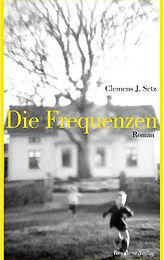
Inhalt
Was ist bloß der Inhalt des Romans?
Es geht jedenfalls um zwei Jugendliche, die als Hauptdarsteller dienen könnten: der eine heißt Walter, der andere ist Alexander (der ich-Erzähler). Beide waren Schulkollegen, haben sich aber aus den Augen verloren – auch deshalb, weil sie keine Schulfreunde waren. Gemeinsam ist ihnen, dass sie den Sprung in die Erwachsenenwelt (noch) nicht geschafft haben und mit ihren Herkunftsfamilien ringen:
 Alexander wurde von seiner überfordert dahinvegetierenden Mutter alleine großgezogen, seit sein Vater eines Tages einfach davonfuhr und die beiden in einer verlassenen Winterlandschaft zurückließ.
Alexander wurde von seiner überfordert dahinvegetierenden Mutter alleine großgezogen, seit sein Vater eines Tages einfach davonfuhr und die beiden in einer verlassenen Winterlandschaft zurückließ.
 Walter, dessen erfolgreicher Vater Vorstellungen über ihn hat, die er wohl nie wird erfüllen können, die er jedoch seiner Familie bemüht vortäuscht.
Walter, dessen erfolgreicher Vater Vorstellungen über ihn hat, die er wohl nie wird erfüllen können, die er jedoch seiner Familie bemüht vortäuscht.
Beide Adoleszenten sind intelligent, jedoch gefüllt mit Selbsthass, Frustration, Lebensüberdruss, Ziellosigkeit, ‚Egalheit‘, Aggression – einfach so richtig pubertär.
Und es passiert ein Mord an einer Frau – mehr wird hier nicht verraten.
Form
 Und dann gibt es ‚Nebendarsteller‘, die auftauchen und sich in den Mittelpunkt schieben, als würden sie mit einer Lupe unwirklich vergrößert, herausgehoben, als ginge es im ganzen Roman nur um sie.
Und dann gibt es ‚Nebendarsteller‘, die auftauchen und sich in den Mittelpunkt schieben, als würden sie mit einer Lupe unwirklich vergrößert, herausgehoben, als ginge es im ganzen Roman nur um sie.
Es ist, als hätte Setz nicht gewusst, wie das Leben der Figuren an den beschriebenen Tagen weiterlaufen würde und es daher für notwendig erachtet, auch ihnen (sicherheitshalber) ausreichend Raum zu geben: man weiß ja im vornherein nicht, auf wen oder was es am Ende wirklich ankommen wird.

Doch nicht nur Figuren (bzw. ein Hund), auch Handlungsstränge fluten in den Vordergrund und verebben wieder rückstandslos, so dass ich mich fragen musste, ob ich nicht ein wichtiges Detail übersehen bzw. in den mehr als 700 Seiten vergessen habe. Andererseits habe ich Querverbindungen und Verweise gefunden, die in scheinbaren Nebensächlichkeiten das Handlungsnetz knüpfen, die Kapitel verbinden, die Geschichte aufbauen.
Wesentlich ist in ‚Die Frequenzen‘ jedenfalls die Art und Weise, wie Setz die Welt aufspannt, wie er Stimmungen beschreibt, Sachverhalte erklärt, die Kapitel parallel führt, zeitlich schachtelt, Blickwinkel verändert, Aussagen formuliert, welche Form er wählt. Oftmals haben mich Setze schmunzeln lassen, betroffen gemacht, überrascht.
Auszüge
Die Beschreibung eines Pflegers im Altenheim, in dem Alexander arbeitet, liest sich so:
„Max ist etwa dreißig, trägt eine Glatze, spricht gern in Ellipsen und hat die Manieren eines nihilistischen Militärarztes.
Er stiehlt gerne Aschenbecher aus Restaurants und baut aus ihnen babylonische Türme aus dunklem Glas. Er wettet auf den Ausgang von Nahost-Friedensverhandlungen wie andere auf Sportergebnisse. Beim Gehen rempelt er alles an, was ihm in den Weg kommt, sogar parkende Autos. Kinder und Tiere meiden ihn.“
Gedanken von Walter, in einem Kleidergeschäft:
„Schaufensterpuppen sind dazu da, uns an den Anblick abgetrennter Köpfe und Gliedmaßen zu gewöhnen; damit wir nicht jedes Mal schreiend davonlaufen, wenn wir sie im wirklichen Leben antreffen.
Verrenkungen, Amputationen, verstümmelte Unfallopfer – wir denken dann automatisch an Mode, die neuesten Herbstfarben und die beruhigende Hintergrundmusik in einem Kaufhaus.“
oder Alexanders Denken, während er für eine Prüfung lernt:
„Nichts kann einen universitären Betrieb für lange Zeit aufhalten. Er hat seinen Teil an der Ewigkeit vor langer Zeit abgemessen. Mathematiker schraffieren weiter kleine Intervalle unter der Gauss’schen Glockenkurve, auch wenn im Nebengebäude geschossen wird. Studenten rekeln sich in der Wiese und prüfen sich gegenseitig, am Nachmittag gehen sie demonstrieren. Ein Bild ewiger Jugend und Gleichgültigkeit.“
Stimmung
Das Buch hat mich fasziniert zurückgelassen –
fasziniert von der Sprache, dem genialen Aufbau, der schrägen Sichtweisen und Wirklichkeitsinterpretation, der Familienverstrickungen.
Das Buch hat mich frustriert zurückgelassen –
frustriert von der vermittelten Stimmung, Aussichtslosigkeit und Belanglosigkeit des Lebens.
Das Leben ist schön – auf der richtigen Frequenz :-),
Thomas


 das Kind (teilweise oder gesamt) die Regeln des Zusammenlebens mit den Eltern bestimmt.
das Kind (teilweise oder gesamt) die Regeln des Zusammenlebens mit den Eltern bestimmt. das Kind schulische Leistung verweigert bzw. in der Schule ‚verhaltensauffällig‘ ist bzw. die Schule schwänzt.
das Kind schulische Leistung verweigert bzw. in der Schule ‚verhaltensauffällig‘ ist bzw. die Schule schwänzt. Haim Omer führt als Randbedingung für therapeutische Maßnahmen ein, dass sie
Haim Omer führt als Randbedingung für therapeutische Maßnahmen ein, dass sie Unter diesen Randbedingungen sind Maßnahmen – je nach Situation und Möglichkeiten der Eltern bzw. des Umfeldes – kreativ zu planen und durchzuführen, um den Eltern ihre Präsenz in der Familie wieder zurückzugeben und damit diese wieder sagen können:
Unter diesen Randbedingungen sind Maßnahmen – je nach Situation und Möglichkeiten der Eltern bzw. des Umfeldes – kreativ zu planen und durchzuführen, um den Eltern ihre Präsenz in der Familie wieder zurückzugeben und damit diese wieder sagen können: