Schoenaker, Theo: MUT TUT GUT. Das Encouraging Training.
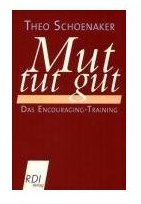 Theo Schoenaker klärt behutsam die Aspekte eines selbstverantworteten Lebens und zeigt Wege, sich selbst dorthin zu bringen. Sein Ansatz ist die „Ermutigung“, auf Englisch „Encouraging“.
Theo Schoenaker klärt behutsam die Aspekte eines selbstverantworteten Lebens und zeigt Wege, sich selbst dorthin zu bringen. Sein Ansatz ist die „Ermutigung“, auf Englisch „Encouraging“.
Den Leser/die Leserin teilweise persönlich ansprechend, startet das Buch bei der „Entmutigenden Gesellschaft„: viele Menschen werden in und durch unserer Gesellschaft entmutigt und leben recht und schlecht mit dem Verlust von Sicherheit und haben Minderwertigkeitsgefühle entwickelt – jedoch in einem normalen, (v)erträglichen Bereich. Insgesamt führt diese Entmutigung jedoch zu „Vermeidung„:
das, was ich machen möchte, das, was ich sehne, kann ich nicht ausleben, da ich entmutigt vermeide. Schoenaker führt hier konkrete Beispiele an, wie sich Vermeidung in Partnerschaft ausdrückt.
 Aber es gibt auch „Ermutigende Erkenntnisse“ über den Menschen selbst, als soziales Wesen, als Entscheidung treffendes Wesen, als zielorientiertes Wesen – aber auch als unvollkommenes Wesen. Schoenaker nennt vier Prioritäten, die das Verhalten des Menschen wesentlich bestimmen:
Aber es gibt auch „Ermutigende Erkenntnisse“ über den Menschen selbst, als soziales Wesen, als Entscheidung treffendes Wesen, als zielorientiertes Wesen – aber auch als unvollkommenes Wesen. Schoenaker nennt vier Prioritäten, die das Verhalten des Menschen wesentlich bestimmen:
- Bequemlichkeit
- Gefallen wollen
- Kontrolle
- Überlegenheit
Die vier Prioritäten sind an sich wertneutral und bei Menschen in unterschiedlichster Gewichtung (Prioritäten) vorzufinden. Jede Priorität hat sowohl positive als auch negative Entwicklungstendenzen in sich. Ein ermutigter Mensch wird seine Prioritäten positiv entfalten, ein entmutigter Mensch negativ. Als Beispiel führe ich Bequemlichkeit an, die ein ermutigter Mensch als „mit sich zufrieden“ ausleben kann, ein entmutigter als „drückt sich vor Verantwortung“.
 Schließlich geht es an die Theorie der „Ermutigung“ selbst: Was wirkt ermutigend? und vor allem: Wie werde ich selbst mutiger (oder besser: mutvoller)? So klar die Antwort auf den ersten Blick scheinen mag, so vorsichtig sollte sie gegeben werden: Wie wirkt Belohnung? Ist Lob wirklich ermutigend? Hier kann „der gesunde Menschenverstand“ in guter Absicht mehr Schaden anrichten, als er nützt.
Schließlich geht es an die Theorie der „Ermutigung“ selbst: Was wirkt ermutigend? und vor allem: Wie werde ich selbst mutiger (oder besser: mutvoller)? So klar die Antwort auf den ersten Blick scheinen mag, so vorsichtig sollte sie gegeben werden: Wie wirkt Belohnung? Ist Lob wirklich ermutigend? Hier kann „der gesunde Menschenverstand“ in guter Absicht mehr Schaden anrichten, als er nützt.
Im Kapitel „Erstrebenswerten Qualitäten“ zählt Schoenaker die für das Zusammenleben zehn wichtigsten Qualitäten auf, beschreibt und argumentiert sie. Es sind dies:
- Interesse für andere
 Aufmerksames Zuhören
Aufmerksames Zuhören- Begeisterung
- Geduld
- Der freundliche Blick
- Die freundliche Stimme
- Das Gute erkennen
- Versuche und Fortschritte anerkennen
- Selbstverantwortliches Handeln
- Körpernähe (-kontakt) herstellen
 Schließlich erläutert Schoenaker „Wege zur Selbst- und Fremdermutigung“ und gibt hier Vorschläge, wie über einen konstruktiv geführten Inneren Dialog Selbstermutigung (und damit die Voraussetzung für Fremdermutigung) passiert. Abgerundet ist auch dieses Kapitel mit Beispielen, hier gibt es auch konkret umsetzbare Übungen.
Schließlich erläutert Schoenaker „Wege zur Selbst- und Fremdermutigung“ und gibt hier Vorschläge, wie über einen konstruktiv geführten Inneren Dialog Selbstermutigung (und damit die Voraussetzung für Fremdermutigung) passiert. Abgerundet ist auch dieses Kapitel mit Beispielen, hier gibt es auch konkret umsetzbare Übungen.
Das Buch hilft in das Thema Ermutigung, das eng gekoppelt ist mit Selbstwert bzw. Minderwertigkeitsgefühl, Wagemut bzw. Vermeidung, Erfolg bzw. Versagensängsten, … einzusteigen und macht wirklich Mut, selbst aktiv zu ermutigen.
Andere, und vor allem: sich selbst.
 MUT TUT GUT ist kein Trainingsbuch oder Ersatz für ein Encouraging-Training: es beschreibt die Basisüberlegungen und gibt einen tiefen, nachvollziehbaren Einblick in die Sichtweise Schoenakers und begründet damit sein Encouraging-Training nach dem Schoenaker-Konzept.
MUT TUT GUT ist kein Trainingsbuch oder Ersatz für ein Encouraging-Training: es beschreibt die Basisüberlegungen und gibt einen tiefen, nachvollziehbaren Einblick in die Sichtweise Schoenakers und begründet damit sein Encouraging-Training nach dem Schoenaker-Konzept.
Der Schreibstil des Buches ist sehr ‚weich‘ und transportiert die Inhalte gut annehmbar. Insgesamt ist „Mut Tut Gut“ leicht lesbar und empfehlenswert für alle, die intensiv mit Menschen umgehen dürfen.
Übrigens: Das Leben ist schön :-),
Thomas
P.S.: Mein Lieblingsvideo zum Thema: Dare. Change.








